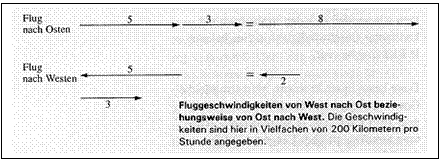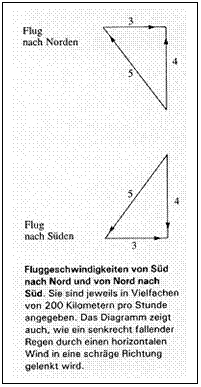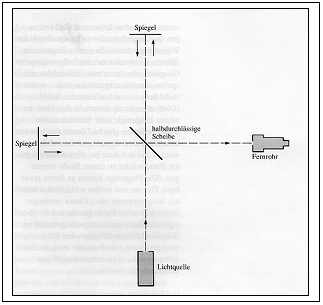Der Widerspruch
Newton und Maxwell schufen – in einem Zeitabstand von zwei
Jahrhunderten Theorien, die jeweils einen großen Erfahrungsbereich beschreiben:
mechanische Bewegungen mit kleinen Geschwindigkeiten (bei Newton) beziehungsweise
Wellenphänomene mit der höchsten bekannten Geschwindigkeit (bei Maxwell). Obwohl
beide Theorien in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich gültig sind, erhebt sich
die Frage, ob sie sich miteinander vereinbaren lassen oder ob sie zu einem Widerspruch
führen.
Rückblickend ist klar, dass ein unvermeidbarer Widerspruch
absehbar war. In der Newtonschen Mechanik wird die Zeit als etwas Absolutes aufgefasst – in dem folgenden Sinne:
Zwei Beobachter werden demselben Ereignis stets denselben Zeitpunkt zuordnen,
unabhängig von Abstand und Geschwindigkeit, die sie relativ zueinander haben.
In dieser Vorstellung steckt implizit die Annahme, dass
sich beide Beobachter in jedem Moment über Signale verständigen können, die
sich mit unendlicher Geschwindigkeit instantan – ausbreiten. Nach all unseren
bisherigen Beobachtungen gibt es aber keine größere Geschwindigkeit als die
Lichtgeschwindigkeit, die nach Maxwells Theorie einen endlichen konstanten Wert
hat. (Verglichen mit alltäglichen Geschwindigkeiten ist dieser Wert so groß,
dass Lichtstrahlen wie instantane Signale erscheinen.) Wenn es tatsächlich in
der Natur keine unendlichen Signalgeschwindigkeiten gibt, ist die Newtonsche
Mechanik in ihren Grundfesten erschüttert.
Unter solchen Bedingungen sollte es jedoch zumindest im
Prinzip möglich sein, experimentell einen Widerspruch zu finden. In einem solchen
Experiment müssten sich Körper so schnell bewegen, dass ihre Geschwindigkeiten
im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit nicht mehr vernachlässigbar klein sind;
die Lichtgeschwindigkeit könnte dann nicht mehr als unendlich groß betrachtet
werden. So hohe Geschwindigkeiten sind aber unter normalen Umständen nicht leicht
zu erreichen, und noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts schien es kaum möglich,
die Theorien von Newton und Maxwell vergleichend zu konfrontieren.
Aber gerade eine solche Konfrontation war – von der Allgemeinheit
unbemerkt – bereits damals in den Vorstellungen eines 16jährigen Schulversagers
im Gange, der von seinen Erziehern als zurückgeblieben und mittelmäßig betrachtet
wurde. Das war Albert Einstein. Er wurde in Maxwells Todesjahr 1879 in Ulm geboren
und wuchs in München auf. Er kam zunächst auf eine katholische Grundschule,
wo ihn die strenge Disziplin und der geistlose Unterricht abstießen. Mit zehn
Jahren wechselte er auf das Luitpold-Gymnasium; aber auch dort besserten sich
seine Leistungen nicht. Er war wie Maxwell – anders als andere.
Seine intellektuelle Neugier wurde zum ersten Mal geweckt,
als er – im Alter von fünf Jahren – einen Kompass geschenkt bekam. Mit zwölf
Jahren stieß er auf die Euklidische Geometrie, von deren Inhalt er tief beeindruckt
war. In einem kleinen Geometriebuch, das in seine Hände geriet, bemerkte Einstein
dann, wie er es ausdrückte, „Aussagen..., (die) – obwohl an sich keineswegs
evident – doch mit solcher Sicherheit bewiesen werden konnten, dass ein Zweifel
ausgeschlossen zu sein schien. Diese Klarheit und Sicherheit machten einen unbeschreiblichen
Eindruck auf mich.“ Das also war der Schüler, der mit 15 Jahren ohne Abschlusszeugnis
die Schule verlassen musste, weil er nichts leiste und seine Gleichgültigkeit
demoralisierend wirke. Nachdem er sich selbst mit Mathematik und Physik vertraut
gemacht hatte, schrieb Einstein sich mit 17 Jahren an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Zürich ein.
Zu dieser Zeit hatte er bereits eine grundlegende Erkenntnis
gewonnen, die er selbst wie folgt beschrieb: „... ein Paradoxon, auf das ich
schon mit 16 Jahren gestoßen bin: Wenn ich einem Lichtstrahl nacheile mit der
Geschwindigkeit c (Lichtgeschwindigkeit im Vakuum), so sollte ich einen
solchen Lichtstrahl als ruhendes, räumlich oszillatorisches elektromagnetisches
Feld wahrnehmen. So etwas scheint es aber nicht zu geben, weder auf Grund der
Erfahrung noch gemäß den Maxwellschen Gleichungen.“
Hier macht Einstein zum ersten Mal von einem Gedankenexperiment
Gebrauch. Die Vorstellungskraft kann praktische Hindernisse überwinden und
Theorien an den äußersten Grenzen ihres Anwendungsbereiches untersuchen.
In der Newtonschen Mechanik sind beliebige Geschwindigkeiten
zugelassen; jeder gleichförmig bewegte Körper kann durch einen anderen eingeholt
werden, so dass die Relativgeschwindigkeit zwischen beiden anschließend Null
beträgt. Ein alltägliches Beispiel dafür ist etwa die Verbrecherjagd in einem
amerikanischen Krimi, wenn ein Polizeifahrzeug den Wagen der Verdächtigen auf
der Autobahn einholt; oder man kann ein Fahrrad an einem Flussufer beobachten,
das auf gleicher Höhe mit einem langsamen Boot fährt. Einstein wandte die Newtonsche
Vorstellung von Relativgeschwindigkeiten auf das Licht an. Es sollte danach
für einen. Beobachter prinzipiell möglich sein, einen Lichtstrahl einzuholen
und sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Ein solcher Beobachter würde die
Lichtwelle zwar im Raum schwingen sehen, könnte aber nicht wahrnehmen,
dass sie sich räumlich fortpflanzt. Nach Maxwells Theorie wird diese Situation
aber niemals eintreten, da sich Licht immer mit derselben Geschwindigkeit c
ausbreitet – entsprechend dem Verhältnis von elektromagnetischer und elektrostatischer
Ladungseinheit.
Und genau hier liegt der Konflikt zwischen Newtons
und Maxwells Theorie. Welche ist falsch? Dabei bedeutet „falsch“, dass die Theorie
außerhalb ihres Geltungsbereiches, in dem sie vorzüglich funktioniert, zusammenbricht.
Wie schon erwähnt, wird die Newtonsche Mechanik in ihren Fundamenten erschüttert,
wenn die Lichtgeschwindigkeit entsprechend der Maxwellschen Voraussage endlich
und unveränderlich ist. Aber wie zuverlässig ist diese Vorhersage Maxwells?
Vielleicht hängt die Geschwindigkeit des Lichtes, das von
einem bewegten Körper abgestrahlt wird, von der Geschwindigkeit dieses Körpers
ab. In unserem Beispiel der Verbrecherjagd würde bei einem Schusswechsel die
Geschwindigkeit einer in Fahrtrichtung abgefeuerten Gewehrkugel um den Betrag
der Autogeschwindigkeit erhöht und umgekehrt die Geschwindigkeit einer nach
hinten abgefeuerten Kugel um den gleichen Betrag verringert. Das jedenfalls
ergibt sich aus Newtons Theorie - insbesondere auch für die Lichtteilchen. Falls
sich Licht tatsächlich so verhielte, stünde die Newtonsche Mechanik auf festem
Boden, aber ob es so ist, lässt sich nur durch Experimente entscheiden.
Das Relativitätsprinzip
Kehren wir zu Einsteins Gedankenexperiment zurück und stellen
wir uns Astronauten in einer schnellen Rakete vor, die versuchen, Lichtpulse
einzuholen, die von einer Blitzlampe auf der Erde ausgehen. Nachdem die Rakete
eine ansehnliche Geschwindigkeit erreicht hat, blicken die Astronauten zurück
und sehen, wie sich Erde und Lampe immer rascher entfernen. Die Lampe ist für
sie also eine bewegte Lichtquelle. Das Licht bewegt sich ungeachtet all ihrer
Bemühungen, es einzuholen, mit konstanter Geschwindigkeit c.
Aber halt! Mit welchem Grund können wir annehmen, dass die
hohe Geschwindigkeit der Astronauten unwichtig sei? Wir wissen bereits, dass
die Bewegung einer Lichtquelle relativ zu einem Beobachter keinen Einfluss auf
die Lichtgeschwindigkeit hat. Gilt dies auch für die Bewegung des Beobachters
relativ zur Lichtquelle? Tatsächlich folgt aus den Gesetzen der Newtonschen
Mechanik für bewegte Körper, dass beide Situationen bei derselben Relativgeschwindigkeit
äquivalent sind. Das ist die Aussage des Relativitätsprinzips, das Galilei
aufgestellt hat.
Gilt dieses Prinzip auch für Wellenbewegungen wie Licht?
Schauen wir uns dazu zunächst eine vertraute Art von Wellen an, wie sie zum
Beispiel auf einer Wasseroberfläche durch ein fahrendes Boot oder einen fallenden
Stein hervorgerufen werden.
Für einen ruhenden Beobachter breiten sich alle Wasserwellen
mit derselben charakteristischen Geschwindigkeit aus – unabhängig davon, ob
sich die Quelle dieser Wellenbewegung parallel zur Oberfläche bewegt oder nicht.
Ein bewegter Beobachter sieht jedoch eine andere Geschwindigkeit, und zwar eine
größere, wenn er sich der Quelle nähert, und eine geringere, wenn er sich von
ihr entfernt. Es ist auch möglich, die Wellen einzuholen und sich mit der gleichen
Geschwindigkeit zu bewegen wie sie. Man denke nur an einen Surfer und dessen
Balanceakt in der Nähe eines Wellenberges. Es gibt noch eine andere Möglichkeit:
Es kann Wind aufkommen und das Wasser vor sich hertreiben. Wellen, die sich
in Windrichtung bewegen, werden dadurch schneller, während sich andere, die
gegen den Wind laufen, verlangsamen.
Wie die Beispiele zeigen, genügt es nicht, allein die Relativbewegung
zwischen Quelle und Beobachter zu betrachten: Darüber hinaus spielt auch das
Medium, in dem sich die Wellen ausbreiten, eine Rolle. Natürlich ist
hier wiederum nur die Relativbewegung ausschlaggebend – nur im Hinblick auf
Quelle, Beobachter und Medium. Die mechanistische Interpretation der
Newtonschen Mechanik, die fast das gesamte 19. Jahrhundert beherrschte, ließ
kaum eine Diskussion darüber aufkommen, ob sich Lichtwellen nur in einem Medium
bewegen können. Wo Wellen sind – sprich Schwingungen –, da muss auch etwas sein,
das schwingt. Diesem schwingenden Etwas gab man den Namen Äther.
Der Äther
Maxwell hat zur historischen Tradition, für alles mögliche
einen "Äther" zu erfinden, folgendes gesagt: „Äther wurden erfunden,
damit die Planeten darin schwimmen können, um elektrische Atmosphären und magnetische
Ausstrahlungen zu beherbergen, um Empfindungen von einem Teil unseres Körpers
zu einem anderen zu übertragen und so fort, bis der ganze Raum mit drei oder
vier verschiedenen Äthern erfüllt war ... Der einzige Äther, der überlebt hat,
wurde von Huygens eingeführt, um die Fortpflanzung des Lichtes zu erklären.
(Er wurde im Zuge des Wiederauflebens der Wellentheorie des Lichtes durch Thomas
Young zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter dem Namen luminophorer Äther wieder
eingeführt.) ... Die Eigenschaften dieses Mediums ... erwiesen sich als genau
die, welche man zur Erklärung elektromagnetischer Phänomene benötigte.“
Die Eigenschaften dieses Äthers waren ebenso eigenartig
wie wunderbar: Er musste dicht und elastisch genug sein, um die Fortpflanzung
elektromagnetischer Schwingungen jeder Frequenz zu gestatten, durfte aber auf
bewegte Materie keinen Widerstand ausüben. Maxwell scheint eine ambivalente
Haltung eingenommen zu haben, was die reale Existenz des Äthers betrifft. Er
benutzte zwar diesen Begriff, kennzeichnete die Sache aber als „äußerst mutmaßliche
wissenschaftliche Hypothese“. Seine Beschreibung des Lichtes als „Wellen, die
sich durch das elektromagnetische Feld bewegen“ klingt sehr modern. Maxwell
schlug auch bereits ein entscheidendes Experiment vor, mit dem sich die Ätherhypothese
überprüfen ließ. Die Grundüberlegungen wollen wir im folgenden skizzieren.
Zunächst müssen wir die Frage untersuchen, ob die Erde den
Äther bei ihrer Bahnbewegung mitzieht oder ob der Äther durch die Erde dringt
„wie der Wind durch ein Wäldchen“ – um ein Bild von Thomas Young zu gebrauchen.
Nun zeigt die beobachtete Aberration des Sternlichtes (siehe Exkurs am
Ende des Textes), dass das Licht eines Sterns geradlinig zur bewegten Erde läuft.
(Als Aberration bezeichnet man dabei die scheinbare Verschiebung von
Sternpositionen im Laufe eines Jahres, die durch die Bahnbewegung der Erde bedingt
ist.) Der Äther, in dem sich das Licht fortpflanzt, wird also nicht von
der Erde mitgezogen. Er verhält sich vielmehr in bezug auf die Erde „wie der
Wind“.
Ähnlich wie Bewegungen der Luft die Schallgeschwindigkeit
verändern, sollte der Ätherwind die Lichtgeschwindigkeit in „Windrichtung“ verändern.
(Diese Richtung ist der Erdbewegung im Äther gerade entgegengesetzt.) Wie Maxwell
bemerkte, ließe sich eine solche Änderung der Lichtgeschwindigkeit messen, wenn
zwei Lichtstrahlen verschiedene Strecken gleicher Länge passieren. Da
sich die Geschwindigkeit des Lichtes je nach Raumrichtung auf unterschiedliche
Weise ändert, sollten unterschiedliche Laufzeiten entstehen. Um diese
Zeitdifferenz zu messen, war jedoch eine Genauigkeit von Eins zu 200 Millionen
erforderlich. (Ich komme darauf zurück.) Maxwell zog deshalb den Schluss, dass
dieses Experiment undurchführbar sei.
In seinem letzten Lebensjahr, 1879, stellte Maxwell in einem
Brief dem Astronomen David Todd (1 855 - 1939) am Nautical Almanac Office in
Washington die Frage, ob die Daten über die Finsternisse der Jupitermonde genau
genug seien, um die Bewegung der Erde durch den Äther festzustellen. In diesem
Brief erwähnt er die „Unmöglichkeit“, ein entsprechendes optisches Experiment
auf der Erde durchzufahren. Aber ein Kollege von Todd erfuhr von dem Brief:
Albert Michelson (1852 – 1932), der bereits die bis dahin genaueste Messung
der Lichtgeschwindigkeit in Luft gemacht hatte.
Eine Analogie
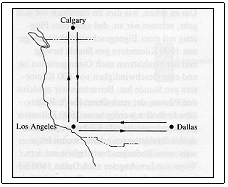 Michelson
nahm die Herausforderung an, das „unmögliche“ optische Experiment in Angriff
zu nehmen. Bevor wir die entscheidende Idee diskutieren, die jene phantastische
Genauigkeit von Eins zu 200 Millionen in den Bereich des Möglichen rücken ließ,
wollen wir eine einfache Analogie betrachten, um Maxwells Plan des Experiments
anhand eines alltäglichen Beispiels zu verdeutlichen. Dazu ersetzen wir die
Lichtgeschwindigkeit im Äther durch eine konstante Geschwindigkeit eines Flugzeugs
in ruhiger Luft. Und an die Stelle des Ätherwindes, der die Lichtgeschwindigkeit
ändert, tritt der in der hohen Atmosphäre herrschende Strahlstrom (Jetstream),
der die Geschwindigkeit von Flugzeugen beträchtlich verändert. Der Einfachheit
halber nehmen wir an, dass sich der Strahlstrom mit konstanter Geschwindigkeit
in eine bekannte Richtung bewegt.
Michelson
nahm die Herausforderung an, das „unmögliche“ optische Experiment in Angriff
zu nehmen. Bevor wir die entscheidende Idee diskutieren, die jene phantastische
Genauigkeit von Eins zu 200 Millionen in den Bereich des Möglichen rücken ließ,
wollen wir eine einfache Analogie betrachten, um Maxwells Plan des Experiments
anhand eines alltäglichen Beispiels zu verdeutlichen. Dazu ersetzen wir die
Lichtgeschwindigkeit im Äther durch eine konstante Geschwindigkeit eines Flugzeugs
in ruhiger Luft. Und an die Stelle des Ätherwindes, der die Lichtgeschwindigkeit
ändert, tritt der in der hohen Atmosphäre herrschende Strahlstrom (Jetstream),
der die Geschwindigkeit von Flugzeugen beträchtlich verändert. Der Einfachheit
halber nehmen wir an, dass sich der Strahlstrom mit konstanter Geschwindigkeit
in eine bekannte Richtung bewegt.
Dann lautet unser Problem: Man ermittle die Geschwindigkeit
des Strahlstromes, indem man zwei Flugzeuge in verschiedener Richtung Strecken
gleicher Länge zweimal durchfliegen lässt und die Abweichung der Flugzeiten
bestimmt.
Ein Flugdienstleiter des Los Angeles International Airport
geht die Sache folgendermaßen an: Er lässt zwei Flugzeuge zur gleichen Zeit
starten, das eine in östlicher Richtung nach Dallas, das andere in nördlicher
Richtung nach Calgary. Beide Städte sind etwa gleich weit von Los Angeles entfernt.
Den Piloten wurde aufgetragen, ihr jeweiliges Ziel anzufliegen und sofort zurückzukehren.
Während des Fluges sollte eine konstante Eigengeschwindigkeit eingehalten werden.
Der Flugdienstleiter kann dann feststellen, welches Flugzeug
wieder zuerst in Los Angeles eintrifft, und den zeitlichen Vorsprung vor dem
anderen Flugzeug bestimmen, um die Geschwindigkeit des Strahlstromes zu berechnen.
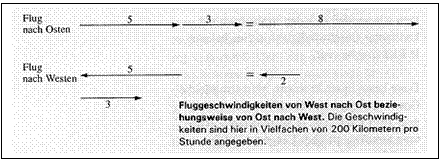 Um zu sehen,
wie dies im einzelnen vor sich geht, nehmen wir an, dass sich jedes Flugzeug
mit einer Eigengeschwindigkeit von genau 1000 Kilometern pro Stunde bewegt und
der Strahlstrom nach Osten gerichtet ist und eine Geschwindigkeit von 600 Kilometern
pro Stunde hat. Betrachten wir zunächst den Piloten, der nach Osten fliegt.
Relativ zum Erdboden werden seine 1000 Kilometer pro Stunde um die 600 Kilometer
pro Stunde des Strahlstromes erhöht, womit insgesamt seine Bodengeschwindigkeit
auf dem Wege von Los Angeles nach Dallas 1600 Kilometer pro Stunde beträgt.
Er erreicht Dallas nach einer gewissen Zeitspanne, die wir als eine Zeiteinheit
festlegen wollen. Auf seinem Rückflug hat er gegen den Strahlstrom anzukämpfen,
seine Bodengeschwindigkeit beträgt jetzt nur 1000 – 600 = 400 Kilometer pro
Stunde – ein Viertel der Geschwindigkeit auf dem Hinflug. Deshalb dauert der
Rückflug viermal so lange, also vier Zeiteinheiten. Das Flugzeug war somit beim
Hin- und Rückflug insgesamt 4 + 1 = 5 Zeiteinheiten unterwegs.
Um zu sehen,
wie dies im einzelnen vor sich geht, nehmen wir an, dass sich jedes Flugzeug
mit einer Eigengeschwindigkeit von genau 1000 Kilometern pro Stunde bewegt und
der Strahlstrom nach Osten gerichtet ist und eine Geschwindigkeit von 600 Kilometern
pro Stunde hat. Betrachten wir zunächst den Piloten, der nach Osten fliegt.
Relativ zum Erdboden werden seine 1000 Kilometer pro Stunde um die 600 Kilometer
pro Stunde des Strahlstromes erhöht, womit insgesamt seine Bodengeschwindigkeit
auf dem Wege von Los Angeles nach Dallas 1600 Kilometer pro Stunde beträgt.
Er erreicht Dallas nach einer gewissen Zeitspanne, die wir als eine Zeiteinheit
festlegen wollen. Auf seinem Rückflug hat er gegen den Strahlstrom anzukämpfen,
seine Bodengeschwindigkeit beträgt jetzt nur 1000 – 600 = 400 Kilometer pro
Stunde – ein Viertel der Geschwindigkeit auf dem Hinflug. Deshalb dauert der
Rückflug viermal so lange, also vier Zeiteinheiten. Das Flugzeug war somit beim
Hin- und Rückflug insgesamt 4 + 1 = 5 Zeiteinheiten unterwegs.
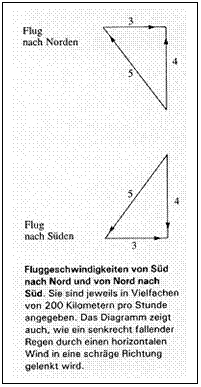 Wie verhält
es sich mit dem Flug nach Calgary? Das Flugzeug, das sich bei ruhiger Luft mit
1000 Kilometern pro Stunde bewegt, wird von dem Strahlstrom mit seinen 600 Kilometer
pro Stunde nach Osten abgedrängt. Um die Nordrichtung beizubehalten, muss der
Pilot etwas gegen den Wind fliegen. Er fliegt mit einer Eigengeschwindigkeit
von 1000 = 5 x 200 Kilometern pro Stunde in nordwestlicher Richtung,
so dass die Kombination dieser Geschwindigkeit mit der ostwärts gerichteten
Geschwindigkeit des Strahlstromes von 600 = 3 x 200 Kilometern pro Stunde eine
genau nach Norden gerichtete Bodengeschwindigkeit von 4 x 200 = 800 Kilometern
pro Stunde ergibt. (Dieses Zahlenverhältnis 3:4:5 der Seiten eines rechtwinkligen
Dreiecks ist das einfachste Beispiel des pythagoräischen Lehrsatzes, der den
zwölfjährigen Einstein so fesselte.) Auf dem Rückflug von Calgary nach Los Angeles
verhält es sich ähnlich. Der Pilot muss in südwestlicher Richtung gegen den
Wind anfliegen, und seine Bodengeschwindigkeit beträgt wiederum 800 Kilometer
pro Stunde. Mit anderen Worten: Das zweite Flugzeug hat in beiden Richtungen
eine Bodengeschwindigkeit, die genau halb so groß ist wie die des ersten Flugzeugs
auf dem Weg von Los Angeles nach Dallas, so dass es zwei Zeiteinheiten für jeden
Weg benötigt, also vier Zeiteinheiten für den gesamten Flug.
Wie verhält
es sich mit dem Flug nach Calgary? Das Flugzeug, das sich bei ruhiger Luft mit
1000 Kilometern pro Stunde bewegt, wird von dem Strahlstrom mit seinen 600 Kilometer
pro Stunde nach Osten abgedrängt. Um die Nordrichtung beizubehalten, muss der
Pilot etwas gegen den Wind fliegen. Er fliegt mit einer Eigengeschwindigkeit
von 1000 = 5 x 200 Kilometern pro Stunde in nordwestlicher Richtung,
so dass die Kombination dieser Geschwindigkeit mit der ostwärts gerichteten
Geschwindigkeit des Strahlstromes von 600 = 3 x 200 Kilometern pro Stunde eine
genau nach Norden gerichtete Bodengeschwindigkeit von 4 x 200 = 800 Kilometern
pro Stunde ergibt. (Dieses Zahlenverhältnis 3:4:5 der Seiten eines rechtwinkligen
Dreiecks ist das einfachste Beispiel des pythagoräischen Lehrsatzes, der den
zwölfjährigen Einstein so fesselte.) Auf dem Rückflug von Calgary nach Los Angeles
verhält es sich ähnlich. Der Pilot muss in südwestlicher Richtung gegen den
Wind anfliegen, und seine Bodengeschwindigkeit beträgt wiederum 800 Kilometer
pro Stunde. Mit anderen Worten: Das zweite Flugzeug hat in beiden Richtungen
eine Bodengeschwindigkeit, die genau halb so groß ist wie die des ersten Flugzeugs
auf dem Weg von Los Angeles nach Dallas, so dass es zwei Zeiteinheiten für jeden
Weg benötigt, also vier Zeiteinheiten für den gesamten Flug.
Wir sehen jetzt, was herauskommt. Der Rundflug senkrecht
zur Richtung des Strahlstromes dauert nur vier Zeiteinheiten, während
der Rundflug parallel zu diesem Strom fünf Zeiteinheiten benötigt. Unser Flugdienstleiter
ersieht aus der Abweichung, dass es einen Strahlstrom gibt, und aus dem Verhältnis
der Flugdauern von 4:5 kann er für das Verhältnis von Strahlstrom Geschwindigkeit
zu Flugzeuggeschwindigkeit den Wert 3:5 ermitteln.
Erinnern wir uns an die Absicht, die hinter dieser Analogie
steckt. Die beiden Flugzeuge repräsentieren zwei Lichtstrahlen, die sich mit
der Geschwindigkeit c im Äther bewegen. Der Strahlstrom, der die Bodengeschwindigkeit
der Flugzeuge ändert, steht für den Ätherwind, der die von der Erde aus gemessene
Lichtgeschwindigkeit verändert. Erinnern wir uns weiterhin daran, dass sich
die Erde durch den Äther bewegen soll. Der Vergleich der beiden Flugzeiten für
zwei senkrecht aufeinander stehende Flugstrecken ist ein Versuch, die Geschwindigkeit
des mit der Erdbewegung verknüpften Ätherwindes zu ermitteln. In unserem einfachen
Zahlenbeispiel erhielten wir als Verhältnis von Strahlstromgeschwindigkeit (v)
zu Flugzeuggeschwindigkeit in ruhender Luft (c) den Wert v/c=3/5. In Michelsons
Experiment ist das Verhältnis der Erdgeschwindigkeit durch den Äther (v) zur
Lichtgeschwindigkeit (c) um vieles kleiner als Eins. Das Verhältnis der Flugzeiten
senkrecht und parallel zum Strahlstrom weicht dann nur um einen winzigen Betrag
von Eins ab. Dieser Betrag entspricht näherungsweise ½ (v/c)2. (Diese
Näherung führt noch für v/c=3/5 zu annehmbaren Ergebnissen.)
Die Idee
Worin bestand nun die entscheidende Idee, die Michelson
bewog, das unmögliche Experiment zu versuchen? Wir wissen bereits, dass Maxwell
eine unbedingt notwendige Messgenauigkeit von Eins zu 200 Millionen ermittelt
hatte. Wir können darin den Wert von ½ (v/c)2 wieder erkennen, wenn
wir für v die Bahngeschwindigkeit der Erde von 30 Kilometern pro Sekunde ansetzen
– was einem Zehntausendstel der Lichtgeschwindigkeit c entspricht. Der
Laufzeitdifferenz der beiden Lichtstrahlen entspricht eine Längendifferenz;
sie ist durch den zeitlichen Vorsprung des zuerst zurückkehrenden Strahls gegeben.
Bei einer Apparatur mit Abmessungen von, sagen wir, 20 Metern, müssten bei dem
Experiment Strecken von einem Hunderttausendstel Zentimeter messbar sein – das
entspricht etwa einem Fünftel der Wellenlänge von sichtbarem Licht.
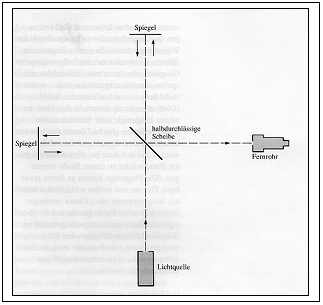 Das Stichwort
"Licht" brachte Michelson auf die entscheidende Idee: Die Wellennatur
des Lichtes und insbesondere seine Interferenzeigenschaften ließen sich für
Messungen im Längenbereich von Bruchteilen einer Wellenlänge nutzen. In seinem
Experiment fällt ein Lichtstrahl auf eine halbverspiegelte Glasplatte, die ihn
in zwei Teilstrahlen aufspaltet: einen durchgehenden und – senkrecht dazu –
einen reflektierten Strahl. (Diese Anordnung entspricht dem Start der beiden
Flugzeuge.) Die Strahlen treffen, nachdem sie die gleiche Distanz durchlaufen
haben, auf zwei Spiegel, wo sie reflektiert werden und sich dann bei der halbverspiegelten
Platte wieder zu einem Strahl vereinigen. (Die Flugzeuge kehren an ihrem jeweiligen
Ziel um und treffen schließlich wieder am Ausgangspunkt ein.) Dieser vereinigte
Strahl fällt in ein Fernrohr, das auf die überlagerten Bilder der Lichtquelle
gerichtet ist. (Die Zeitdifferenz zwischen den Flügen wird gemessen.) Im Fernrohr
wird die Zeitdifferenz anhand einer Interferenzfigur sichtbar.
Das Stichwort
"Licht" brachte Michelson auf die entscheidende Idee: Die Wellennatur
des Lichtes und insbesondere seine Interferenzeigenschaften ließen sich für
Messungen im Längenbereich von Bruchteilen einer Wellenlänge nutzen. In seinem
Experiment fällt ein Lichtstrahl auf eine halbverspiegelte Glasplatte, die ihn
in zwei Teilstrahlen aufspaltet: einen durchgehenden und – senkrecht dazu –
einen reflektierten Strahl. (Diese Anordnung entspricht dem Start der beiden
Flugzeuge.) Die Strahlen treffen, nachdem sie die gleiche Distanz durchlaufen
haben, auf zwei Spiegel, wo sie reflektiert werden und sich dann bei der halbverspiegelten
Platte wieder zu einem Strahl vereinigen. (Die Flugzeuge kehren an ihrem jeweiligen
Ziel um und treffen schließlich wieder am Ausgangspunkt ein.) Dieser vereinigte
Strahl fällt in ein Fernrohr, das auf die überlagerten Bilder der Lichtquelle
gerichtet ist. (Die Zeitdifferenz zwischen den Flügen wird gemessen.) Im Fernrohr
wird die Zeitdifferenz anhand einer Interferenzfigur sichtbar.
In Michelsons Apparatur sind die beiden überlagerten und
interferierenden Lichtstrahlen räumlich etwas gegeneinander versetzt, da sie
von verschiedenen Seiten der verspiegelten Plattenseite ausgehen. Diese Verschiebung
ruft im Fernrohr ein Interferenzbild hervor, das aus einer Folge von dunklen
und hellen Lichtstreifen besteht.
Die Lage dieser Streifen innerhalb der Interferenzfigur
hängt von der Laufzeitdifferenz der beiden Strahlen ab. Um diese Differenz erfassen
zu können, muss man die relativen Laufzeiten der beiden Strahlen ändern,
so dass sich die Interferenzstreifen messbar verschieben. Eine Änderung
der Laufzeit lässt sich erreichen, indem man einen Strahl relativ zum anderen
bewegt. Wird dabei ein Strahl relativ zum anderen gerade um eine Wellenlänge
verschoben, „wandert“ das Interferenzbild genau um einen Streifen weiter und
unterscheidet sich deshalb nicht von dem ursprünglichen Bild. Für kleinere Verschiebungen
um den Bruchteil eines Streifens ist diese Methode also bestens geeignet und
das heißt, für Abstandsänderungen um den Bruchteil einer Wellenlänge.
So weit, so gut. Aber wie lässt sich die relative Laufzeit
beider Strahlen verändern? Erinnern wir uns an die Flugzeuge. Angenommen, an
irgendeinem Tag weht der Strahlstrom gerade nach Norden statt nach Osten. An
einem solchen Tag würde das Flugzeug aus Calgary erst später zurückkehren als
die Maschine aus Dallas. Um also die Existenz des Ätherwindes nachweisen zu
können, müssen wir seine Richtung ändern. In der Praxis heißt das, dass wir
die Orientierung der Lichtwege relativ zum Ätherwind ändern müssen – indem wir
die Apparatur drehen.
Das Experiment
Kehren wir zu Michelson und seiner Besessenheit von dem
„unmöglichen“ Experiment zurück. Seine erste Interferenzmessung machte er während
eines Studienaufenthaltes zwischen 1880 und 1882 in Berlin mit finanzieller
Unterstützung von Alexander Graham Bell (1819 – 1905). Michelsons Apparatur
hatte jedoch noch mehrere Schwachstellen. Die Arme mit den reflektierenden Spiegeln
ließen nur eine kurze Lichtlaufstrecke zu, und ihre Justierung wurde beim Drehen
des Instrumentes verstellt. Der Berliner Verkehr tat ein übriges, indem er störende
Vibrationen hervorrief – und das bereits ab zwei Uhr morgens.
Das entscheidende Experiment gelang 1887, als sich Michelson
während eines Aufenthaltes an der Case School of Applied Science in Cleveland,
Ohio, mit Edward C. Morley (1838-1923) zusammentat, einem Chemieprofessor der
nahegelegenen Western Reserve University. (Die beiden Universitäten sind heute
unter dem Namen Case Western Reserve vereint.) Gemeinsam verbesserten sie die
Apparatur, um deren Schwächen auszugleichen. So konnten sie die Laufstrecke
des Lichtes beträchtlich vergrößern, indem sie die Strahlen mehrmals zur Reflexion
brachten. Das Licht durchlief jetzt eine effektive Entfernung von etwa 22 Metern,
was 40 Millionen Wellenlängen des gelben Natriumlichtes entsprach. (Mit Hilfe
dieses Lichtes wurde der Apparat sorgfältig eingerichtet.) Um darüber hinaus
die Stabilität zu erhöhen und Vibrationen zu dämpfen, wurden die optischen Teile
auf eine massive Sandsteinplatte montiert, die auf einer Quecksilberschicht
schwimmend gelagert war. Das löste auch die Probleme, die anfangs beim Drehen
des Apparates aufgetaucht waren. Einmal in Bewegung gesetzt, drehte er sich
stundenlang langsam weiter, so dass eine genaue Beobachtung der Streifen an
16 entlang eines Kreises markierten Positionen möglich war.
Schließlich wurde, beginnend mit dem 8. Juli 1887, an mehreren
aufeinander folgenden Tagen jeweils zur gleichen Tageszeit gemessen: um 12 und
18 Uhr. In diesem Sechs-Stunden-Intervall wurde das Laboratorium durch die Erdrotation
90 Grad um die Erdachse gedreht, was eine maximale Verschiebung der Streifen
– um vier Zehntel eines Streifens – erwarten ließ. Und welche Veränderungen
beobachtete man zwischen diesen Tageszeiten nun wirklich?
Keine. Die Interferenzstreifen verschoben sich Überhaupt nicht.
Natürlich hatte das Experiment nur eine endliche Genauigkeit; Verschiebungen
ließen sich nur bis zu einem Hundertstel der Streifenbreite nachweisen. Seither
wurde dieses Experiment mit moderneren Instrumenten und beträchtlich höherer
Genauigkeit wiederholt, aber das Ergebnis blieb dasselbe. Das Michelson-Morley-Experiment
und sein negativer Befund waren eindeutig: Es gibt keinen Äther als Lichtmedium.
Relativität
Bei der Beschreibung dieses historischen Experiments habe
ich auf die historische Begründung zurückgegriffen, die mit der Vorstellung
des Äthers verknüpft ist. Die paradoxen Eigenschaften eines solchen Äthers lassen
sich jedoch umgehen, wenn man die von Michelson und Morley beantwortete Frage
folgendermaßen stellt: Bezieht sich Maxwells Theorie, in der sich elektromagnetische
Wellen mit der Geschwindigkeit c bewegen, möglicherweise auf ein bestimmtes
Bezugssystem, nämlich ein Ruhesystem, das seinen Beobachter als absolut ruhend
auszeichnet? Wenn ja, dann sollte ein Beobachter, der sich relativ zu diesem
Ruhesystem bewegt, eine von c abweichende Geschwindigkeit messen. Das
Michelson-Morley-Experiment besagt eindeutig, dass es kein solches ausgezeichnetes
Bezugssystem gibt. Alle Bezugssysteme, die sich relativ zueinander mit gleichförmiger
Geschwindigkeit bewegen, sind äquivalent. Dies gilt sowohl für mechanische Bewegungen
als auch für elektromagnetische Wellen. Ein Zustand absoluter Ruhe hat also
keinerlei physikalische Bedeutung.
Es sollten aber noch 18 Jahre vergehen, bis einer es wagte,
jene beiden Aussagen als allgemeine Gesetze zu formulieren, die zwar durch die
Theorie des Elektromagnetismus nahegelegt und durch das Experiment gestützt
wurden, aber mit der Newtonschen Physik unvereinbar waren. Diese Gesetze
sind:
1. Das Relativitätsprinzip: Zwei Beobachter,
die sich in Inertialsystem
mit gleichförmiger Geschwindigkeit relativ zueinander bewegen, werden für alle
Phänomene gleichwertige (äquivalente) Beschreibungen geben. Für beide Beobachter
gelten dieselben physikalischen Gesetze.
2. Zu diesen Gesetzen gehört die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit
im Vakuum. Diese Geschwindigkeit ist für alle Beobachter in Inertialsystemen
gleich, sofern sie sich relativ zueinander in gleichförmiges Bewegung befinden.
Die Sprache, die Albert Einstein 1905 dafür gebrauchte,
war weniger knapp. Er schrieb dazu,
1'. „... dass vielmehr für alle Koordinatensysteme, für
welche die mechanischen Gleichungen gelten, auch die gleichen elektrodynamischen
und optischen Gesetze gelten... „
2'. „... dass sich das Licht im leeren Raum stets mit einer
bestimmten, vom Bewegungszustande des emittierenden Körpers unabhängigen Geschwindigkeit
c fortpflanze“.
Wir bemerken, dass sich die ursprüngliche Aussage des zweiten
Postulats auf die Bewegung des emittierenden Körpers bezieht, während wir die
Bewegung des Beobachters hervorgehoben haben. Einsteins erstes Postulat stellt
die Äquivalenz beider Versionen sicher.
Exkurs:
Die Aberration des Sternlichtes
Im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert wurde die Suche nach
einem direkten Beweis der Kopernikanischen Theorie verstärkt fortgesetzt. Aus
der Annahme, dass sich die Erde in einem Jahr um die Sonne bewegt, zog man den
Schluss, dass sich die Richtung eines bestimmten Sterns nach sechs Monaten,
wenn sich die Erde auf der anderen Seite ihrer Bahn befindet, ändern müsse.
Eine solche Positionsverschiebung können wir leicht bei
einem, nahen Objekt beobachten, wenn wir beim Betrachten abwechselnd das rechte
und linke Auge schließen; es handelt sich hier um die Grundlage des stereoskopischen
Sehens.
Im Jahre 1725 beobachtete James Bradley (1693 – 1762) eine
solche Verschiebung bei einem Stern, den man von London aus im Zenit beobachtet.
Aber irgendetwas stimmte nicht. Die maximale Positionsverschiebung war in den
falschen Jahreszeiten zu verzeichnen – als die Erde gegenüber der jeweils erwarteten
Bahnposition um ein Viertel ihrer Bahn abwich. Als Bradley zwei Jahre später
während einer steten Brise auf der Themse segelte, betrachtete er fasziniert,
wie die Fahne am Mast bei einem Kurswechsel des Bootes ihre Richtung änderte.
Das gab ihm den entscheidenden Gedanken: Die Verschiebung der Sternposition
beruhte nicht auf der Ortsänderung der Erde während ihrer Bahnbewegung,
sondern auf der Geschwindigkeitsänderung der Erde während eines Umlaufs.
Als beliebter Vergleich wird hier ein Mensch mit Regenschirm
angeführt. Wenn man im senkrecht fallenden Regen steht, muss man den Schirm
senkrecht halten, um maximalen Schutz zu bekommen. Beim Gehen muss man ihn in
Vorwärtsrichtung neigen, um geschützt zu bleiben, und zwar um so mehr, je schneller
man geht.
Ersetzen wir den Regen durch Sternlicht, den Schirm durch ein Teleskop und den
Schirmträger durch die Erde auf ihrer Bahn, so läuft das Ganze auf Bradleys
Erklärung für die Aberration des Sternlichtes hinaus.
Die Vorstellung von einem Lichtstrahl, der auf einer geraden
Linie vom Stern zur sich bewegenden Erde läuft, liefert eine vollständige Erklärung
für die jahreszeitliche Richtungsänderung der Sternposition. Würde sich das
Licht in einem Äther fortpflanzen, der von der bewegten Erde mitgezogen wird,
so ergäbe sich keine Positionsverschiebung. Um in unserem Vergleich mit dem
Regen zu sprechen: Es wäre dann so, als ob in dem Augenblick, in dem man losgeht,
ein Wind aufkäme, der den Regen in dieselbe Richtung triebe, in die man geht,
und zwar genau mit derselben Geschwindigkeit.
Der Text ist frei übernommen aus dem Buch:
Einsteins Erbe, Die Einheit von Raum und Zeit
erschienen im Spektrum Verlag, 1987
Dasselbe gilt für den Raum. Newtons
berühmter Zeitgenosse, Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), der 1673
zum auswärtigen Mitglied der Royal Society gewählt wurde, war anderer Meinung.
Raum war für Leibniz eine Eigenschaft der Phänomene und somit, wie auch die
Zeit, ein relativer Begriff.
Eine weitere große Schwierigkeit
war folgende: In einem gewöhnlichen Festkörper gibt es zwei Arten von Wellen:
longitudinale, bei denen die Schwingungsrichtung mit der Bewegungsrichtung
übereinstimmt (das ist bei Schallwellen der Fall), und transversale, bei denen
die Schwingungsrichtung senkrecht zur Bewegungsrichtung steht. Schon Christian
Huygens hatte entdeckt, dass Lichtwellen immer transversal sind. (Dies lässt
sich mit Polarisationsgläsern anschaulich zeigen, die nur eine der beiden
möglichen Transversalschwingungen passieren lassen. Zwei solche Polarisatoren,
deren Polarisationsrichtungen rechtwinklig zueinander stehen, löschen einen
Lichtstrahl vollständig aus.) Um die Abwesenheit longitudinaler Lichtwellen
erklären zu können, mussten dem Äther die Eigenschaften eines inkompressiblen
Festkörpers zugeschrieben werden.
Für einen Beobachter in einem Inertialsystem
breitet sich Licht im Vakuum geradlinig aus, und kräftefreie Körper folgen
geraden Bahnen. Ein Beobachter, der sich relativ zu einem Beobachter in einem
Inertialsystem dreht, ist selbst kein inertialer Beobachter.
Entsprechendes
passiert, wenn die Person stehen bleibt und ein Wind aufkomrnt, der den Regen
in horizontaler Richtung bewegt.
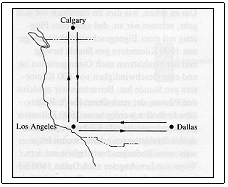 Michelson
nahm die Herausforderung an, das „unmögliche“ optische Experiment in Angriff
zu nehmen. Bevor wir die entscheidende Idee diskutieren, die jene phantastische
Genauigkeit von Eins zu 200 Millionen in den Bereich des Möglichen rücken ließ,
wollen wir eine einfache Analogie betrachten, um Maxwells Plan des Experiments
anhand eines alltäglichen Beispiels zu verdeutlichen. Dazu ersetzen wir die
Lichtgeschwindigkeit im Äther durch eine konstante Geschwindigkeit eines Flugzeugs
in ruhiger Luft. Und an die Stelle des Ätherwindes, der die Lichtgeschwindigkeit
ändert, tritt der in der hohen Atmosphäre herrschende Strahlstrom (Jetstream),
der die Geschwindigkeit von Flugzeugen beträchtlich verändert. Der Einfachheit
halber nehmen wir an, dass sich der Strahlstrom mit konstanter Geschwindigkeit
in eine bekannte Richtung bewegt.
Michelson
nahm die Herausforderung an, das „unmögliche“ optische Experiment in Angriff
zu nehmen. Bevor wir die entscheidende Idee diskutieren, die jene phantastische
Genauigkeit von Eins zu 200 Millionen in den Bereich des Möglichen rücken ließ,
wollen wir eine einfache Analogie betrachten, um Maxwells Plan des Experiments
anhand eines alltäglichen Beispiels zu verdeutlichen. Dazu ersetzen wir die
Lichtgeschwindigkeit im Äther durch eine konstante Geschwindigkeit eines Flugzeugs
in ruhiger Luft. Und an die Stelle des Ätherwindes, der die Lichtgeschwindigkeit
ändert, tritt der in der hohen Atmosphäre herrschende Strahlstrom (Jetstream),
der die Geschwindigkeit von Flugzeugen beträchtlich verändert. Der Einfachheit
halber nehmen wir an, dass sich der Strahlstrom mit konstanter Geschwindigkeit
in eine bekannte Richtung bewegt.