U-Haft im Kristall
Münchner Physiker fanden einen Trick, mit dem sich Licht auf einen Bruchteil seiner normalen
Geschwindigkeit herunterbremsen lässt.
Rund 300 000 Kilometer legt ein Lichtstrahl
je Sekunde zurück - zum Glück. Denn bräuchte ein Schimmer vom Moment des Entstehens
zum Betrachter nach Alltagsmaßstäben nennenswerte Zeit, wäre ein Augenblick
nicht so kurz wie ein Augenblick.
Auch Ingenieure freuen sich über das
Tempo, denn so können Lichtimpulse ungeheure Informationsmengen mit aberwitzigen
Geschwindigkeiten übermitteln. Unzählige Kilometer von Glasfaserkabeln werden
darum Tag für Tag in der Erde vergraben, um die Datennetze der Zukunft zu knüpfen.
Doch bisweilen bereitet die Hurtigkeit
des Lichts arges Kopfzerbrechen, denn seine Strahlen können nicht anders als
mit Maximalgeschwindigkeit herumsausen. Gern würden Telekommunikationsexperten
die Lichtnachrichten in optischen Datennetzen auch ohne Umweg durch elektronische
Schaltungen weiterverarbeiten, Informatiker träumen von unvorstellbar schnellen
"optischen Computern" - doch das scheint utopisch, weil die flüchtigen
Lichtblitze sich bisher nicht zum Sortieren und Verrechnen einfangen lassen.
Münchner Physiker haben einen Ausweg
aus diesem Dilemma entdeckt: Sie fanden eine Methode, mit der sich Licht vorübergehend
in Untersuchungshaft nehmen lässt.
Von "Photonenförderbändern"
und "surfenden Elektronen" spricht Achim Wixforth, 42, wenn er die
Experimente erklärt, die die Fachwelt in Erstaunen setzen. Er benutzt die trickreiche
Kombination verschiedener physikalischer Effekte, etwa die Veränderung eines
Kristalls durch Schallwellen, um das Licht einzufangen.
Knapp 400 000stel Sekunden Speicherzeit
konnte er mit seinen Methoden schon erzielen - nach Lichtmaßstäben eine Ewigkeit:
Ungehindert wäre das Leuchten in dieser Zeit schon zehn Kilometer davongeeilt.
Wixforths Lichtfalle besteht aus einem
wenige Millimeter messenden Kristall aus verschiedenen Galliumarsenid-Verbindungen.
Solche sogenannten Quantentöpfe sind die Basis vieler Halbleiter-Bauelemente,
zum Beispiel auch des Lasers, der im CD-Player die Platten abtastet.
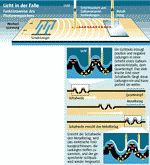 Im Quantentopf sind die Elektronen
in einer hauchdünnen Schicht unter der Oberfläche des Kristalls gefangen. Trifft
Licht auf den Halbleiter, entstehen positive und negative Ladungen, die normalerweise
unmittelbar, der Kraft ihrer wechselseitigen Anziehung folgend, zusammenprallen
und ihr kurzes Leben unter Aussendung eines Lichtblitzes wieder aushauchen.
Im Quantentopf sind die Elektronen
in einer hauchdünnen Schicht unter der Oberfläche des Kristalls gefangen. Trifft
Licht auf den Halbleiter, entstehen positive und negative Ladungen, die normalerweise
unmittelbar, der Kraft ihrer wechselseitigen Anziehung folgend, zusammenprallen
und ihr kurzes Leben unter Aussendung eines Lichtblitzes wieder aushauchen.
Wixforth und seine Mitarbeiter fanden
einen Weg, die spontane Vereinigung zu verhindern: Sie lassen eine Schallwelle
durch den Kristall laufen. Dabei nutzen sie aus, dass Galliumarsenid piezoelektrisch
ist - es verformt sich unter dem Einfluss elektrischer Felder (siehe Graphik).
Fingerförmige Elektroden auf seiner
Oberfläche lösen unter dem Einfluss einer Wechselspannung von etwa einer Milliarde
Schwingungen pro Sekunde eine Art Mini-Beben in dem Kristall aus. Wie eine Falte
durch ein kräftig gebeuteltes Bettlaken läuft die angeregte Schwingung als Welle
über die Oberfläche.
Die Wellen sind winzig. Ihre Kämme
sind nur einige millionstel Millimeter hoch, Berge und Täler liegen rund einen
tausendstel Millimeter auseinander, doch der Effekt ist enorm: Das Beben knetet
den Halbleiter mit Drücken von 10 000 Bar durch, und mit der Welle rast ein
elektrisches Feld von einigen tausend Volt je Zentimeter Stärke durch den Kristall.
Dieses Feld reißt jene Ladungen auseinander,
die durch einfallende Lichtblitze entstehen, und zwingt sie, wie Surfer mit
der Schallwelle über den Kristall zu reisen. Im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit
bewegen sich die Ladungen nun geradezu im Schneckentempo: Während jener Zeit,
in der ein Lichtstrahl schon einen Kilometer zurückgelegt hätte, kommen die
surfenden Ladungen gerade mal einen Zentimeter voran.
Ein dünner Metallfilm am anderen Ende
des Kristalls beendet die Untersuchungshaft. Läuft die Welle auf diesen Strand,
schließt der Metallbelag das elektrische Feld kurz - prompt stürzen sich die
gefangenen Ladungen aufeinander und setzen den gespeicherten Lichtblitz wieder
frei.
"Es gibt keinen offensichtlichen
physikalischen Grund, der der Speicherzeit Grenzen setzt", erläutert Wixforth,
"wie lange das geht, müssen wir erst noch herausfinden."
Schon die bereits erreichte Haftzeit
ist sensationell lang. Bisher bleibt Technikern ohne Zuhilfenahme von Elektronik
nichts anders übrig, als kilometerlange Glasfaserumwege, die meist auf klobige
Spulen gewickelt sind, in ihre Netze zu schalten, wenn Lichtimpulse auch nur
millionstel Sekunden verzögert werden sollen. Wixforths Kristall-Surfsee könnte
die Aufgabe in einem kompakten Bauelement erfüllen.
Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt:
Die in der Schallwelle gefangenen Lichtblitze lassen sich nach Belieben herumschubsen.
So können zwei Schallwellen, die den Kristall im rechten Winkel zueinander durchqueren,
das Licht an beliebige Orte auf dem Halbleiter transportieren, bevor sie es
wieder freilassen. So ließen sich Daten zwischen verschiedenen Glasfasern hin-
und herschalten.
Als nächstes wollen die Forscher einen
Kristall präparieren, in dem verschieden umlaufende Schallwellen das eingesperrte
Licht im Kreis bugsieren. "Vielleicht können wir Impulse dann sogar für
eine Sekunde festhalten", mutmaßt Doktorand Martin Streibl.
Streibl hat, einer spontanen Idee folgend,
auch noch eine Art Kamera nach diesem Prinzip gebaut. Weil die vom Licht erzeugten
Ladungen ihrerseits die Ausbreitung der Schallwelle beeinflussen, lässt sich
aus der Analyse des Schalls das Lichtmuster auf dem Halbleiterkristall rekonstruieren.
Wie ein Computertomograph aus Schatten im Röntgenbild ein Bild des Körperinnern
errechnet, haben die Forscher in ersten Experimenten schon einfache, auf die
Probe projizierte Buchstaben per Computer wieder sichtbar gemacht.
Selten ist der praktische Nutzen eines
neuen physikalischen Effektes so offensichtlich wie im Fall des Münchner Lichtspeichers.
Die Forschungslabors der großen Telekommunikationskonzerne arbeiten seit Jahren
daran, die Kapazität der Datenstrecken zu erhöhen - an Lichtwellen als Übertragungsmedium
führt kein Weg vorbei.
Wixforth erhielt für seine Entdeckung
letztes Jahr den Walter-Schottky-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft,
doch auch wenn Hochschulpolitiker in Grundsatzreden immer wieder mehr Anwendungsnähe
von den Universitäten fordern - Unterstützung für die Weiterentwicklung seiner
Idee zur Praxisreife fand der Physiker bisher nicht.
Die Gebühren für mehrere deutsche Patente
auf die Technik zahlten die Forscher aus eigener Tasche. Den nächsten Schritt,
ein Weltpatent, das mit Anwaltsgebühren etwa 100 000 Mark kosten würde, können
sie sich nicht leisten.
Selbst eigens gegründete Patentberatungsstellen
für Hochschulforscher geben Entwicklungen, die auch nur einige Jahre von der
Anwendung entfernt sind, kaum eine Chance: Solche Gremien, so musste der Wissenschaftler
inzwischen mehrfach feststellen, interessierten sich meist nur für marktreife
Bauelemente, "bei denen man nur noch über die Farbe des Gehäuses nachzudenken
braucht".
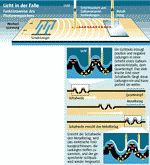 Im Quantentopf sind die Elektronen
in einer hauchdünnen Schicht unter der Oberfläche des Kristalls gefangen. Trifft
Licht auf den Halbleiter, entstehen positive und negative Ladungen, die normalerweise
unmittelbar, der Kraft ihrer wechselseitigen Anziehung folgend, zusammenprallen
und ihr kurzes Leben unter Aussendung eines Lichtblitzes wieder aushauchen.
Im Quantentopf sind die Elektronen
in einer hauchdünnen Schicht unter der Oberfläche des Kristalls gefangen. Trifft
Licht auf den Halbleiter, entstehen positive und negative Ladungen, die normalerweise
unmittelbar, der Kraft ihrer wechselseitigen Anziehung folgend, zusammenprallen
und ihr kurzes Leben unter Aussendung eines Lichtblitzes wieder aushauchen.